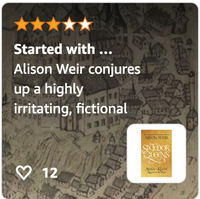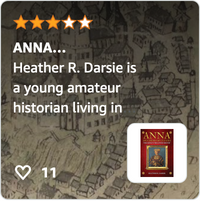Customer Reviews by Cleveslander [alias Roland Norget]
Started with a mad fantasy about teen Anna –
promptly hit harsh with wrongly clustered characters
Reviewed in the United Kingdom on 24 May 2019 / Verified Purchase
Alison Weir conjures up a highly irritating, fictional picture of Anna with alleged new insights and evidences along the historical lines - but due to a hidden leak of relevant historical local knowledge, the barge immediately strands on the striking cliff of swan knight Lohengrin's castle in Cleve.
Alison Weir, rightly praised and popular by readers and critics, moves on slippery ice in flat Clevesland and gets into an avoidable role. What went wrong with Alison Weir's fictional narrative from the beginning of the first part with five chapters called "Princess of Kleve" (pp. 3-82)? The review primarily refers to the contents of the first part of the fictional narrative and concentrates on the non-fictional, supposedly historically transmitted contents of the narrative. ...
Rezension auf Amazon komplett lesen:
https://www.amazon.co.uk/review/R1T4SV87NU61BZ/ref=pe_1572281_66412651_cm_rv_eml_rv0_rv
ANNA DUCHESS (?) of CLEVES. Approached properly,
but failed due to the author's own point of view
Reviewed in the United Kingdom on 3 August 2019 /
Verified Purchase
Heather R. Darsie is a young amateur historian living in the USA. As she expresses in her self-portrait, the focus of her interest in history has been for about 10 years on Tudor figures and the Holy Roman Empire. As a bibliophile, she turned her attention to illuminated manuscripts.
Heather studied abroad, e.g. in France with visits in Germany, and got a Bachelor of Arts in German Languages and Literature, and a Juris Doctorate. All this, as she says, has helped her gain perspective as to the political world stage during the Renaissance - and to Anna of Cleves. She researched Anna's life from the German perspective, which fleshes out her life story and her family history.
Anna’s life has been reviewed mostly from a perspective of foreign observers using English or American sources. Anna piqued Heather's interest back in 2012, and she set out to read any book on her that she could find. They all told the same, basic story of the second half of her life since the selection of King Henry VIII had fallen on her as his fourth wife in the autumn of 1539. ...
Rezension auf Amazon komplett lesen:
Transkript (Englisch – Deutsch):
Gestartet mit einer irrwitzigen Fantasie über Teenie Anna –
prompt hart aufgeschlagen durch falsch interpretierte Charaktere
Alison Weir zaubert ein höchst irritierendes, fiktives Bild von Anna mit vermeintlich neuen Erkenntnissen und Beweisen entlang der historischen Linien aus dem Hut – doch aufgrund versteckter Lecks mangels relevantem historischen Wissen über Annas Heimat strandet der Kahn sogleich an der markanten Klippe der Burg des Schwanenritters Lohengrin in Cleve.
Alison Weir, zu Recht von Lesern und Kritikern gelobt und beliebt, bewegt sich im flachen 'Clevesland' auf glattem Eis und gerät in vermeidbare Turbulenzen. Was ist schief gelaufen bei Alison Weirs fiktiver Erzählung, die mit dem ersten Teil "Prinzessin von Cleve" (S. 3-82) in fünf Kapiteln beginnt? Die Rezension bezieht sich in erster Linie auf den Inhalt des ersten Teils der fiktionalen Erzählung und konzentriert sich auf die nicht-fiktionalen, vermeintlich historisch überlieferten Inhalte der Erzählung.
Zunächst einmal ist der Verlag verantwortlich dafür, dass das (dem Rezensenten vorliegende) gebundene Buch weder ein Inhaltsverzeichnis noch einen Index hat. Wenig leserfreundlich! Der Leser muss sich den voluminösen Geschichtsroman (511 S.) selbst strukturieren: zwei vereinfachte Stammblätter, fünf Teile mit 30 Kapiteln (S. 3-485), 'Author's Note' (S. 487-496), 'Dramatis Personae' (S. 497-504), 'Timeline' (S. 505-508) und schließlich 'Reading Group Questions' (S. 509-511). Dürftig – mit unterschiedlich gewichteten narrativen Räumen, aber ohne konkrete Quellenangaben!
Thematisch stellt sich die Frage, warum Alison Anna "von Kleve" (Buchumschlag) oder "von Kleve" (vgl. S. 487) nennt? Seit Zeiten der Sage vom Schwanenritter Helias Gral (im 8. Jahrhundert) lautete die Schreibweise bis Anfang der 1930er Jahre "Cleve". Und zu Recht zitiert Alison Anna selbst als "Tochter von Cleve", und verwendet nicht das modernisierte "Kleve". Aber das ist nur eine Petitesse unter Irritationen mit offen bleibenden Fragen.
Leider wird zudem das Verständnis der Handlung in Alisons Geschichte erschwert durch die gewaltige Ansammlung von mehr als 200 Personen ("Dramatis Personae", S. 497-504), davon mehr als 50 aus dem gesamten Umfeld von "Kleve" (eigentlich Cleve-Mark-Ravenstein, Jülich-Berg-Ravensberg und Geldern-Zutphen), den Lesern den Zugang zu ihrer ansonsten stilvoll erzählten und einzigartig inszenierten Fiktion. Viele Figuren heißen angeblich "von Kleve" (siehe S. 497-504). Dies ist nur in ganz wenigen Fällen zutreffend. Ein prägnantes Beispiel: Annas Eltern Johann und Maria waren nie "Herzog und Herzogin von Kleve". Maria war die Erbin von Jülich-Berg, also "Herzogin von Jülich-Berg" aus eigenem Recht. Johann III. genannt "der Friedfertige" wurde 1511 angeheirateter "Herzog von Jülich-Berg" und 1521 Herzog der "Vereinigten Herzogtümer Jülich-Cleve-Berg", der "Grafschaft Mark", der "Herrschaft Ravenstein" a. d. Maas und der "Grafschaft Ravensberg" in Westfalen.
Gleich zu Beginn des Romans verfängt sich die Autorin in den Fallstricken der Genealogie des lokalen Adels. Alison Weir hat sich wohl zu sehr auf die unten aufgeführten, eigentlich erstklassigen Sekundärquellen verlassen. Aber auch diese englischen und amerikanischen Autoren haben sich gelegentlich im Labyrinth und Dickicht nicht nur der (angeblich etwa 70) unehelichen Kinder von Herzog Johann I. und Johann II. verstrickt. Besonders schwer zu entwirren ist der weit verzweigte und einflussreiche 'von Wylich-Clan' in 'Clevesland' alias 'Duchy of Cleve'. Hohe Gefahr eines Absturzes...!
Zu Recht lobt Alison Weir in ihrer 'Author's Note' (S. 487-496) ihre Fakten- und Ideengeber aus dem Kreis ihrer angesehenen Kollegen englischer und amerikanischer Historiker (S. 495), die Annas nicht-fiktionales Leben in den letzten 20 Jahren in hervorragenden wissenschaftlichen Studien systematisch erforscht haben. Ein brandneues biografisches Buch über Annas Leben - geschrieben von einer jungen US-Bürgerin, mehrsprachig ausgebildeten Hobbyhistorikerin und brillant recherchiert auf der Basis von Primärquellen - muss zwangsläufig übersehen worden sein, weil es zur gleichen Zeit (April 2019) im UK erschienen ist.
Das Stammblatt soll die historisch korrekte Grundlage für die Erzählung schaffen. Doch in Adolfs Linie steckt der Teufel im Detail! Das stark vereinfachte und teilweise falsche Stammblatt "Kleve - Haus La Marck" lenkt den realen historischen Hintergrund der Geschichte von Anfang an ins Abseits. Der vorgestellte Adolf ist definitiv nicht der ehelich geborene Sohn von Johann I., sondern tatsächlich sein unehelich geborener Sohn gleichen Namens. So kann es nunmal im wahren Leben zugehen! Eine Recherce in Primärquellen hätte den folgenreichen Fauxpas aufgedeckt und der Autorin Unannehmlichkeiten erspart.
Die Ursache des Fehlers liegt auf der Hand: Alison Weir scheint - wie sie selbst andeutungsweise darlegt - die lokalen Charaktere aus einer Familiengenealogie mit Ursprung in Cleve übernommen zu haben. Die genealogische Homepage wurde von Auswanderern aus einer lokalen Adelsfamilie erstellt und ist eigentlich sehr authentisch. Aber hier (Adolfs Herkunft) und dort (Othos Herkunft) scheinen die Darstellungen hinterfragungsbedürftig oder schwer interpretierbar zu sein. Gleichwohl hätte die Abstammung von Annas Otho entschlüsselt werden können, wer weiß?
Dieses uralte Rittergeschlecht (seit dem 13. Jahrhundert) der 'von Ossenbroich' ('Ochsenbruch') war am Osthang der Schwanenburg in dem kleinen Dorf Till ansässig. Die ehemalige Burg existiert heute nicht mehr. Im Jahr 1539 soll eine Tochter des Hauses von Ossenbroich namens Gerberge (* 1500 und verheiratet mit dem Hofmeister Johann von Wylich, Herr van Steenhuis) Anna auf ihrem Weg nach England als Gentlewoman begleitet haben. Übrigens: Die jungen, unverheirateten Gentlewomen wurden am Tudorhof 'Dutch Maiden', und das ganze Gefolge 'Cleveslanders' genannt.
Der "falsche" Adolf dominiert den entsprechenden Zweig im Stammblatt. Herzog Johann I. hatte tatsächlich einen Adolf als zweitgeborenen, ehelichen Sohn, der, wie korrekt angegeben, von 1461 bis 1498 lebte. Dieser Adolf schlug eine kirchliche Laufbahn ein und war zeitlebens Kanoniker im Bistum Lüttich (Teil des niederrheinisch-westfälischen Reichskreises). Adolf hatte keine Frau und keine Nachkommen.
Johann I. hatte also noch einen zweiten Sohn namens Adolf, später Herr zu Büderich (Teil von Wesel), der um 1465 unehelich geboren wurde und dessen Mutter aus dem Geschlecht derer von der Rosau in Bienen bei Rees (rechtsrheinisch im Herzogtum Kleve) stammte. Adolfs zweiter Halbbruder Herzog Johann II. genannt 'de Kindermaker' gab Adolf nach dessen Hochzeit mit Alexandrine van Tengnagel 1492 die Burg Grondstein bei Elten (ebenfalls rechtsrheinisch) im Herzogtum Cleve als Lehen.
Adolf nannte sich nun "Herr von Grondstein" alias "zu Büderich". Das Paar bekam zwei Kinder, die sich "von Grondstein" nannten: Elisabeth und Johann. Elisabeths späterer Ehemann Otto von Wylich (ca. 1480–1557) ist ebenfalls gut dokumentiert. Otto von Wylich und Elisabeth von Grondstein bekamen fünf eheliche Kinder. Otto gehörte zum Rat des Herzogs und wurde Drost von Gennep an der Maas und 'Herr van Grubbenvorst' bei Venlo/Nord-Limburg.
Otho soll Ottos angeblich illegaler Sohn gewesen sein. Weder in den Primärquellen noch anderswo ist dies bisher zuverlässig belegt. Wer des Rätsels Lösung kennt, der möge es lüften..!
Der Autorin spielte diese illegitime Herkunft in die Karten ihrer fiktiven Erzählung um "Liebe und Schmerz" des ungleichen Paares Anna & Otho, auf die im späteren Leben noch weitere Pein zukommen sollte. Und was haben die verliebten Teenager in den verwinkelten Gängen und Nischen der Schwanenburg gemacht...? Was wohl: kuscheln und küssen, aber daraus entstehen keine Babys... Irrtum: Neun Monate später wurde auf Schloss Burg an der Wupper ein Junge geboren, der den Taufnamen Johann erhielt. Bingo! Was für eine Schande für die hochgeborene Herzogstochter ...!
Aber wichtiger ist, dass Otho im wirklichen Leben neben Anna die wichtigste männliche Hauptrolle spielt – mal abgesehen von Seiner Majestät König Heinrich VIII. Tatsächlich spielte Otho in Annas wirklichem Leben eine herausragende und privilegierte Rolle, auch wenn seine Herkunft und sein Leben bis heute im dichten Nebel bleiben. Otho war der treueste Gefolgsmann und Begleiter in Annas wahrem Leben in England von 1540 bis 1556.
Unter nicht ganz geklärten Umständen wurde Otho Ende 1556 durch üble Intrigen von Annas Vetter Franz II., jüngster Sohn von Annas gleichnamiger Patentante und ihrem Ehemann Graf von Waldeck-Eisenberg, und von Annas wenig geliebtem Bruder Herzog Wilhelm V. für immer aus England vertrieben. Ein schwerer Schlag für Anna mit erheblichen Auswirkungen... Wilhelm V. – posthum 'der Reiche' genannt, d. h. reich an Grundbesitz, aber arm an inneren Werten – galt als äußerst herrschsüchtig insb. gegenüber seinen drei Schwestern und fünf Töchtern. Vor seiner Mutter kuschte er jedoch.
Abschließend noch zwei besonders bemerkenswerte Aspekte der Erzählung, die ohne Berücksichtigung der realen Geschichte nicht nachvollziehbar sind. In Alison Weirs fiktivem Roman beginnen die Handlungen im Sommer 1530. Es ist die Zeit der Familiengeburtstage der Herzogfamilie. Die meisten Geburtstage fallen in die Monate Juni, Juli und August: Anna (* 28. Juni 1515), Wilhelm (* 28. Juli 1516) und deren Mutter Herzogin Maria (* 03. August 1491). Vielleicht saß Anna Ende Juni 1530 ungeduldig am Fenster ihrer Kemenate und blickte von der Schwanenburg über den Felsen nach Südosten in die Rheinaue, in der Erwartung, dass ihre Verwandten endlich eintreffen würden. Zu Annas 15. Geburtstag war sicherlich ein Festmahl vorbereitet worden ... Auf der Schwanenburg breitet sich also über die Sommermonate wiederholt fröhliche Geburtstagsstimmung aus.
Anna wurde nachweislich am Tag vor St. Peter und Paul geboren, am 28. Juni 1515, und nicht am 22. September 1515 und wahrscheinlich auch nicht in Düsseldorf. Warum nicht dort? Das Düsseldorfer Schloss war am 23. Dezember 1510 in weiten Teilen niedergebrannt. Über viele, viele Jahre fehlten die Finanzmittel zum Wiederaufbau. Von den drei Hauptwohnsitzen in Jülich-Cleve-Berg war nur die Schwanenburg in gutem Zustand und zudem stets bewohnt. Auch die Jülicher Stammburg der Maria von Jülich-Berg, ihr "Schloss Hambach", war 1515 eine Brandruine. Ausgerechnet am Tag des Lichtfestes, der Schutzpatronin der Türwärter (St. Lucia), hatten die Türwärter kräftig gezecht und das Schloss nicht aufmerksam bewacht. Am 13. Dezember 1512 stand es lichterloh in Flammen ... Welche Ironie des Schicksals..!
Die Patin der kleinen Anna – vom Lehrmeister Konrad Heresbach, dem Hauslehrer des Prinzen Wilhelm, "Klein Anneken" genannt – war Annas väterliche, gleichnamige Anna von Cleve (* 1495), die einzige ehelich geborene Schwester ihres Vaters Johann III. Das neugeborene Mädchen Anna wurde vermutlich in der Burgkapelle oder der Stiftskirche St. Mariä Himmelfahrt im Angesicht der Schwanenburg getauft. Anna wurde nach ihrer Urgroßmutter mütterlicherseits, Kurfürstin Anna von Sachsen (1437-1512), benannt, die nur drei Jahre († 1512) vor der Geburt der kleinen Anna starb. Übrigens wurden seit ca. 100 Jahren alle legitimen Prinzessinnen und Prinzen des Herzoghofs von Cleve (ab 1416/17; insgesamt 23, über vier Generationen) auf der Schwanenburg geboren.
Und natürlich hätte auch Annas geliebte Patentante Anna Gräfin von Waldeck-Eisenberg mit ihren Kindern kommen können, um den 15. Geburtstag ihres Patenkindes zu feiern. Auch das jüngste Kind der Gräfin, Annas Lieblingscousin "Fränzchen", erst vier Jahre alt, wäre sicherlich dabei gewesen. Dieser Grafensohn "Franz II." wird später eine wichtige Rolle in Annas realem Leben und in Alisons fiktiver Erzählung spielen ...
Und der eigentliche "Geburtstags-Knüller" fehlt noch: Am 28. Juni hat auch Heinrich VIII. Geburtstag (* 28. Juni 1491 im Palace of Placentia in Greenwich). Gleicher Geburtstag wie Anna und gleiches Geburtsjahr wie Annas Mutter Maria von Jülich-Berg. Und damit genau 24 volle Lebensjahre älter als seine vierte Braut Anna (in spe ...). Aber wir lesen nichts über diese erstaunlichen und vielleicht (un-)glücklichen Zufälle des Lebens ..!
Die Erzählung hätte auch für das Jahr 1540, den 28. Juni, ein Highlight parat gehabt: Fiktive Einladung zu einem rauschenden Fest des königlichen Hofes an den Ufern der Themse. Das Königspaar Anna und Heinrich VIII. lädt Höflinge und Volk zum zweiten Top-Ereignis des Jahres 1540 ein: "Doppelter Geburtstag von König und Königin"! Zur Enttäuschung des Adels und Volkes war im Mai bereits die Krönungszeremonie ins Wasser gefallen... Ein einzigartiges Ereignis im Königshaus, im wahrsten Sinne des Wortes ...!
Aber nein, das hätte gar nicht klappen können, denn Anna war am Vortag (siehe Zeitleiste, S. 507) nach Richmond ins "Exil" geschickt worden – ein damals gezielt gegen Anna vorgetäuschter "Pestalarm" für London. Eigentlich barer Unsinn, aber der Geheime Rat (Privy Council) brütete heimlich (im Hampton Court Palace) über der Trennungsvereinbarung ... Bald würde alles vorbei sein...!
Spuren von Annas realem Leben und Alisons Erzählung führen in das Jahr 1539 und zum Porträt-Ereignis im August für Anna & Amalia (Nickname "Emily") vor den künstlerischen Augen von Hans Holbein d. J.! Der 'King's Painter' von Heinrich VIII. reiste von London aus in die Jülichsche Heimatregion der Familie des Herzogs, um Porträts der beiden Prinzessinnen zu malen.
Zuvor hatte es eine Debatte darüber gegeben, wer von den kontinentalen Meistermalern die Prinzessinnen malen dürfe. "Meister Wertinger" oder "Meister Cranach", wie Alison Weir schreibt (S. 57), und wer käme sonst noch in Frage. "Meister Wertinger" aus Landshut/Bayern scheint mit "Meister Barthel Bruyn dem Älteren" oder seiner Werkstatt aus Köln verwechselt worden zu sein. Bruyns Werkstatt in Köln malte im Auftrag des Herzoghofes zu dieser Zeit vermutlich das lange verschollen geglaubte und heute im 'Rosenbach Museum' in Philadelphia erhaltene Porträt von Anna. Ähnliche Porträtgemälde aus jener Zeit gelten als Kopien. Wertinger hat vermutlich nie eine Anfrage oder einen Auftrag des Herzogs erhalten. Und von Lucas Cranach d. Ä. war bekannt, dass er zu jener Zeit angeblich krankheitsbedingt verhindert war.
Weiter schreibt Alison Weir, dass das Ereignis in einem angeblichen "Schloss Düren" stattfand (S. 57). Ein Schloss in Düren hat es nie gegeben, und mit "Wilhelms Jagdschloss in Hochebenen des Herzogtums Jülich" dürfte Schloss Hambach gemeint gewesen sein. Annas berühmtes Porträt ist in Holbeins Werkstatt in Whitehall gemalt worden, nachdem der 'King's Painter' die Zeichnung auf Pergament um den 10. August 1539 im Wasserschloss Burgau in Niederau bei Düren angefertigt hatte.
Warum dort? Im August 1539 war Schloss Burg das Trauerhaus der Familie und der Witwensitz der Herzogin. Die herzogliche Familie hatte seit etwa dreißig Jahren regelmäßig umziehend überwiegend in den Residenzen im Bergischen, Jülichschen und Clever Land (Clevesland) gelebt. Die Kanzlei des Vereinigten Herzogtums befand sich seit 1521 in der Hauptresidenz Burg Düsseldorf. Herzog Johann III. war im Februar 1539 in seiner Heimat auf dem ehemaligen, herzoglichen Witwensitz Burg Monterberg bei Calcar nahe Cleve gestorben und in der Fürstengruft der Stiftskirche Cleve bestattet worden. Die intakte Residenz Schwanenburg Cleve war für die Witwe und ihre beiden Töchter wie auch für die englische Delegation zu weit entfernt und schwer erreichbar. Die Herzoginwitwe bevorzugte wegen dieser Umstände für die Porträtstudien einen ruhigen Ort in ihrem angestammten Herzogtum Jülich-Berg.
Die herzogliche Residenz und Wilhelms Jagdschloss dort war das "Schloss Hambach" in Niederzier bei Jülich und Düren, das nach dem Brand von 1512 lange vor 1539 renoviert worden war und in neuem Glanz erstrahlte (bis zur Zerstörung durch kaiserliche Truppen im August 1543). Mutter Maria könnte sich aus guten Gründen entschieden haben, diese zukunftsentscheidende Aktion für ihre beiden Töchter nicht hier unter vielen Höflingen verantalten zu lassen. Ein viel zu geschäftiges Umfeld und neugierigen Blicken ausgesetzt!
Die mit Maria von Jülich-Berg eng befreundete Familie 'von Elmpt' hatte für dieses wichtige Ereignis ihr abgelegenes und verstecktes Lehnsgut Schloss Burgau zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus war die engste Freundin der Herzogin, Sibylle Sophie von Nesselrode alias 'Lady Keteler', mit einer zweiten Miteigentümerfamilie des Schlosses Burgau verwandt. Lady Keteler, deren Familiensitz sich in der Nähe von Schloss Burg befand, führte Ende 1539 das Brautgeleit nach London an. Lady Keteler wurde Annas erste Hofdame ('Great Lady') an Annas Hochzeitstag, dem 6. Januar 1540.
Der Leser fragt sich: Kennt die Autorin diese Fakten nicht oder warum konstruiert sie ohne Not Fakes, die zu Irrungen und Wirrungen führen?
Alison Weir verschenkt diese besonderen Chancen, Geschichte auf Basis von spannenden Fakten lebendig werden zu lassen und nebenbei Annas weitverbreites falsches Geburtsdatum zu korrigieren wie auch weitere, bisher wenig bekannte historische Fakten aufleben zu lassen. So ist die Erzählung viel zu sehr auf die fiktive Liebesaffäre mit ihren Folgen fixiert und vernachlässigt großen Erzählstoff entlang der Geschichte, der sich idealerweise angeboten hätte. Weirs Roman soll offenkundig Sensationsphantasien beflügeln, um Verkaufserfolge zu generieren.
Einen Bigpoint muss man der Autorin allerdings zugestehen. Alison Weir hat versucht, Annas Image als 'Flandernstute' auszumerzen – starker Tobak, der über Jahrhunderte hinweg über Anna posthum erzählt wurde.
Auf der anderen Seite droht dem Image der wahren, nicht-fiktionalen Anna durch das Narrativ des historischen Romans neues Ungemach. Weir irritiert mit ihrem vorurteilsbehafteten, spekulativen Menschenbild über Anna, die "nah am Ellenbogen" ihrer Mutter aufgewachsen und streng behütet worden sei. Deswegen sei schwer vorstellbar, dass Anna Gelegenheit für unbemerkte Techtelmechtel gehabt hätte. Annas Unschuld und ihr erstes Verliebtsein als Teenie könnte sie jedoch anfällig für Verführungen gemacht haben. Möglicherweise habe einer ihrer vielen Cousins, die eigentlich als unverdächtige Gesellschaft betrachtet werden konnten, Anna ausnutzen können. Anna könnte eine willige Gespielin gewesen sein: schließlich sei Anna die Enkelin des libidinösen Kindermachers (Johann II.). Später habe man über Anna erzählt, sie sei dem Wein zugeneigt gewesen und habe teils ausschweifend gelebt. Und es habe Gerüchte über eine verborgene Schwangerschaft gegeben. Weir: "Ich befürchtete, dass ich Anna mit derartigen Spekulationen ein großes Unrecht zufügen würde, aber als ich ihre Geschichte weiter recherchierte, fand ich Beweise, die man als Bestätigung ansehen könnte..." (p 489).
Frei nach der Floskel: "Wie der Großvater, so die Enkelin"... Und eine Alkoholikerin obendrein ... (Anna "...eine Säuferin?", siehe S. 58). Was hat Weir bezweckt ..? Mit derartigen Plattitüden lassen sich nun gerade keine Vorurteile bekämpfen, sondern befeuern ...!
Flirts, Liebschaften und feucht-fröhliche Feiern seien Anna in Ehren gegönnt – aber Rufmord wäre inakzeptabel! Wir sind mit Anna nicht im Roman über Kitty alias Katheryne Howard...!
Schließlich kriegt Weir die Kurve zur Rehabilitierung von Annas untadeligem Ruf und platziert auf dem vorderen Innenumschlag des Buches: "... Sie war eine charmante, temperamentvolle Frau, die von allen geliebt wurde, die sie kannten - und schließlich sogar von dem König, der sie zurückwies." Wohl wahr, bitte stürmisch applaudieren!
Aber lesen Sie am besten selbst über die 'Königin der Geheimnisse' – es könnte recht unterhaltsam und bei kritischer Distanz lehrreich sein! Urteilen Sie selbst im Dschungel von Non-Fiction und Fiction, Gerüchten, Spekulationen, angeblichen neuen Beweisen, Fakten und "Fake News"... Moderne Zeiten!
./.
ANNA HERZOGIN (?) von Cleve:
Annäherung an sich vielversprechend, aber an der Sichtweise der Autorin gescheitert
Heather R. Darsie ist eine junge Hobbyhistorikerin, die in den USA lebt. Wie sie in ihrem Selbstporträt ausdrückt, liegt der Schwerpunkt ihres Interesses an der Geschichte seit etwa 10 Jahren auf Tudor-Figuren und am Geschehen im Heiligen Römischen Reich. Als Bibliophile haben illuminierte Manuskripte ihre besondere Aufmerksamkeit gefunden.
Heather hat im Ausland studiert, u. a. in Frankreich mit Studienaufenthalten in Deutschland, und einen Bachelor of Arts in deutscher Sprache und Literatur sowie ein US-Juris Doktorat erworben. All dies, wie sie sagt, hat ihr geholfen, eine Perspektive auf die politische Weltbühne in der Renaissance zu gewinnen – und auf 'Anna von Cleve'. Sie untersuchte Annas Leben aus deutscher Sicht, was Annas Lebensgeschichte und ihre Familiengeschichte aus Heathers Feder verdeutlichen soll.
Annas Leben wurde bisher hauptsächlich aus der Perspektive ausländischer Beobachter unter Verwendung englischer oder amerikanischer Quellen betrachtet. Anna hat Heathers Interesse bereits 2012 geweckt, und sie machte sich daran, jedes Buch über sie zu lesen, das sie finden konnte. Sie alle erzählten die gleiche, grundlegende Geschichte der zweiten Hälfte ihres Lebens, nachdem die Wahl von König Heinrich VIII. im Herbst 1539 auf sie als seine vierte Frau gefallen war.
Das Buch enthält neue und vergessene Porträts von Anna und ihrer Familie. Es soll dem Anspruch gerecht werden, ihr wahres Leben kennenzulernen, mit Beschreibungen dessen, was in ihrem wahren Leben zu Hause von 1515 bis 1539 vor sich ging, bis hin zu ihrer schicksalhaften Ehe mit Heinrich VIII. Die Biographie versucht zu verstehen, was genau während ihrer Heirat mit Heinrich VIII. und ihrem späteren Platz in der Gesellschaft nach Juli 1540 geschah.
Das hat Heather selbst als Anspruch erhoben. Erfüllt Heather diesen Anspruch? In der Wahrnehmung des Rezensenten leider nur sehr begrenzt, und das ist enttäuschend! Wie fast erwartet, ist ihr Versuch weitgehend gescheitert! Warum?
Es gibt einige Hauptgründe für dieses Scheitern. Erstens hat Heather Mut gezeigt und glaubte, aufgrund ihrer akademischen Ausbildung und ihres besonderen Interesses an Renaissance-Figuren eine Biographie über Anna von Cleve schreiben und veröffentlichen zu können. Das verdient Respekt und Anerkennung, denn Anna ist eine Herausforderung der besonderen Art.
Nach Ansicht des Rezensenten liegt der Mangel in Heathers zu fokussierter Sicht einer Juristin, die sie derart geleitet hat. Heather scheint sich zu sehr in ihrer "Juris Doctorate"-Prägung verstrickt zu haben, da sie in juristischen, hierarchischen und machtpolitisch-dynastischen Kategorien denkt, die Top-Down-Ansichten auf Annas Welt werfen. Aber das war nicht Annas Welt - nur die Umstände ihres politisch beeinflussten Lebens! Heather hat Annas Leben schlichtweg nicht erfasst!
Nicht dynastisch-politische Lebensumstände, sondern soziale, reale Alltagsbeziehungen wie bei jeder gewöhnlichen Person waren für Anna wichtig (Freunde, keine Institutionen)! Stattdessen lesen wir zu viele überflüssige Dinge über viele Fehden und Kriege. Heather präsentiert ihren Lesern bestenfalls die bekannten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Aber wer waren ihre Freunde zu Hause und in England, wem vertraute sie, wer waren ihre engsten Vertrauten, die an ihrer Seite lebten?
Anna ist und bleibt ein unbekanntes Wesen, das sich nicht in ihr Innerstes schauen ließ und fast nichts Persönliches schriftlich geschrieben oder hinterlassen hat. Wir wissen praktisch nichts über ihr wirkliches Leben. Aber wir können uns ihr indirekt nähern! Nur wie?
Das Leitmotiv hätte lauten müssen: Zeige mir die Menschen deiner sozialen Interaktionen, und ich werde dir sagen, wer du bist! Wer waren Annas Freunde und die Freunde von Annas Familie? Welche sozialen Beziehungen gab es überhaupt? Gab es familiäre Sorgen und gesundheitliche Probleme?
Heather wagte sich dem zwar zu nähern, aber es hätte ihr besser gelingen können, weil sie in den Archiven relevante Fakten vor ihren Augen gehabt haben muss. Ein Beispiel: Annas Familie litt seit Generationen unter massiven gesundheitlichen Problemen mit schweren Erbkrankheiten bei Männern und Frauen: starke Verformung der Wirbelsäule (Skoliose). Bei Männern Idiotie, die immer wieder die männlichen Linien von Jülich-Berg auszulöschen drohte. Annas ganze Familie war von diesen Krankheiten betroffen. Forensische und psychiatrische Berichte von Medizinern waren für Heather öffentlich zugänglich.
Wir lesen nichts über all das!
Anna ist immer bescheiden geblieben und hat sich nicht selbst erhöht: "Anna, die Tochter von Cleve". Geboren als Herzogstochter "Anna von Cleve" und nicht als "Anna, Herzogin von Cleve", wie Heathers mehr als unverständliche Titelfigur: ein formales Konstrukt, das faktisch nicht zutrifft. Zu keiner Zeit war Anna eine Herzogin – weder geboren noch gekoren! Und auch nicht als Tochter einer "Herzogin von Cleve" geboren - ihre Mutter war "Herzogin von Jülich-Berg" aus eigenem Recht. Zu Annas Geburtszeit war auch Ihr Vater (noch) kein "Herzog von Cleve".
Heather hat Annas familiären Ursprung und das soziale Leben zu sehr vernachlässigt oder unvollkommen beschrieben und erklärt. 'Anna von La Marck' – ein nicht erklärbares Namenskonstrukt . Und warum heißt Anna "von Cleve" und nicht "von der Marck" oder "von der Mark"? Einfache Leserfragen, faktisch beantwortbar, aber nicht beantwortet. Anna erhielt ihren Namen auch nicht von ihrer gleichnamigen (Paten-)Tante, sondern von ihrer mütterlichen Urgroßmutter "Anna von Sachsen" (gestorben 1512). Damals sah das katholische Brauchtum noch keine Tante oder Patin vor, die dem Taufkind ihren Namen gab, sondern bevorzugt die maternale Großmutter (Sibylle von Brandenburg) – Sibylle vergeben an die erstgeborene Tochter – oder die maternale Urgroßmutter (Anna von Sachsen), vergeben an die zweitgeborene Tochter Anna.
Stattdessen geht Heather den langen Weg komplizierter Gedankengänge, die in der Geschichte ihrer väterlichen Familie einen langen Weg zurückreichen. Dagegen werden ihre mütterlichen Vorfahren vollständig vernachlässigt; für Leser ohne Vorkenntnisse kaum zugängliche Gedankengänge zur Vorfahrengeschichte. Ein väterlicher Stammbaum des Hauses "von der Mark" und ein mütterlicher Stammbaum der Häuser "von Jülich-Berg" wäre hilfreicher gewesen als die beiden bekannten genealogischen Tabellen von Edward I. (Haus Plantagenet) und des Hauses Cleve-Burgund. Aufgrund ihrer intensiven Forschung hätte Heather dies eigentlich alles wahrnehmen können, aber sie präsentiert uns ein schwaches Leistungsergebnis! Warum all diese Figuren in Worten und Bildern, die nichts mit Annas wirklichem Leben zu tun hatten (Erasmus, Jeanne d'Albret, Marguerite d'Angoulême, Häuser von Aragón und Dänemark usw.).
Kaum jemand lernt einige dieser wichtigen Menschen ihres Lebensumfeldes kennen, wie Konrad Heresbach (Meisterschüler von Erasmus und mit Heinrich VIII. persönlich bekannt), Lady von Nesselrode (ihre Kinder – Spielkameraden in Annas Kindheit – und erste Ehrendame resp. 'Great Lady' bei Annas Hochzeit), Otto van Wylich (Annas engster Vertrauter und privater Hofmeister), Annas Freunde (u. a. Jasper Brockhuizen und seine Ehefrau Gertrude) und andere.
Annas engste Vertraute seit Beginn ihres England-Abenteuers wurde Lady Gilman alias Susanna Horenbout. Susanna wurde vom Nürnberger Künstler Friedrich Dürer hoch geschätzt, nicht minder ihr Bruder Lucas, erstrangiger Maler der Gemälde-Werkstatt am Tudorhof, 'King's Painter' und hochrangiger sowie besser bezahlt als der später bestallte Hans Holbein d. J. Susanna gilt als talentierte Miniaturistin mit hoher Wertschätzung am Tudorhof. Susanna wurde Annas erste Hofdame im 'Privy Council' des Haushalts der Königin. Beide blieben eng verbunden auch nach Annas Eheannullierung.
Annas engste englische Freunde in ihrer glücklichsten Lebensphase in Blechtingley waren Sir William Howard (1. Baron von Effingham) und seine Familie im benachbarten Reigate. Anna kennt Williams berühmten Sohn, den späteren Lord High Admiral Charles Howard von Queen Elizabeth I., seit seiner Kindheit. Diese engen Freunde von Anna sind nur eine kleine Auswahl, um zu veranschaulichen, was Heather hätte tun können, um ihre eigenen Erwartungen und die der Leser zu erfüllen. Chance vertan!
Nicht zuletzt überzeugt die gesamte Struktur der so genannten Biographie nicht, weil eine klare Struktur nicht erkennbar ist und das Verständnis für die Leser erschwert!
Heather hat sich auf eine Metaebene begeben, auf der Menschen mit formaler Macht über Annas Kopf ihre Politik machen, und wir erfahren fast nichts über das wirkliche Leben in Annas Alltag. Eine Biographie muss Anna als Mensch mit ihrem beeindruckenden Lebenswerk gerecht werden und nicht als unpersönliches Instrument der Ehepolitik. Gleichwohl empfielt der Rezensent die Lektüre des Buches, die jedoch weder für Anfänger in der Geschichte der Vereinigten Herzogtümer Cleve-Mark, Jülich-Berg-Ravensberg und des Herzogtums Geldern-Zutphen (1538-1543) geeignet erscheint noch Fortgeschrittenen mit guten Kenntnissen über die Herkunft und den Lebensweg der "Anna von Cleve" wesentlich Neues zu präsentieren vermag.
./.